Studienreise nach Wien: Wandeln auf den Spuren Alfred Adlers
Erleben Sie Wien – die goldene Stadt, Geburtsstätte und langjähriger Wirkungsort von Dr. Alfred Adler.
Wann? Sonntag, 31. August 2025, Beginn: 9.00 Uhr Ende: ca. 16.00 Uhr
Wer? Ruth & Urs R. Bärtschi, Peter Pollak & Irene Poensgen
Gemeinsam mit unserer professionellen Reiseleiterin Birgit besichtigen wir Adlers Geburtshaus, das Wiener Center für Individualpsychologie mit kleiner Ausstellung und natürlich das berühmte Café Central, in dem Alfred Adler referierte und diskutierte. Natürlich darf auch der Besuch an Adlers Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof nicht fehlen.
Freuen Sie sich ausserdem auf kurze Impulse, Geschichten und Anekdoten aus dem Leben dieser aussergewöhnlichen Persönlichkeit. Im Anschluss an die Führung werden wir den Tag fakultativ bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingen lassen. Einstimmen auf den Studientag «auf den Spuren Alfred Adlers»: Geniesse Wien & die Gemeinschaft bei einem fakultativen Abendessen am Samstagabend. Von uns organisiert, jedoch von jedem selbst bezahlt (nicht im Preis für den Studientag inbegriffen).
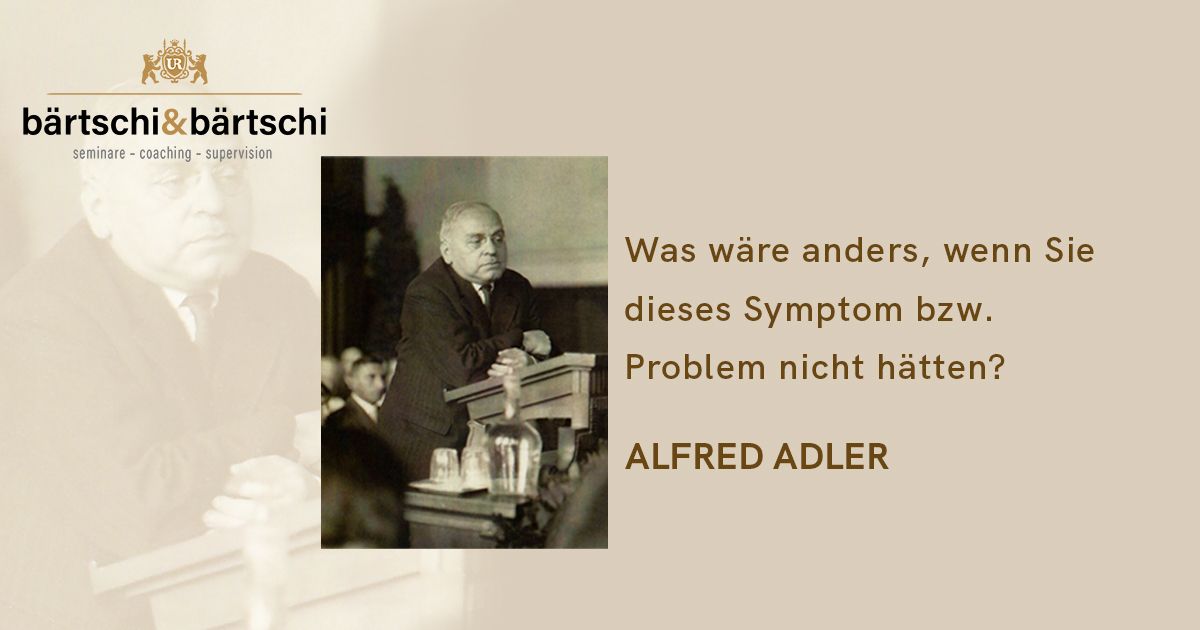
Wien, Stadt der Psychologie: aus Österreich in die Welt
Entdecken Sie die Geburtsstadt der berühmten Wiener Psychologen, entdecken Sie die historisch wichtigen Gebäude und Strassen. In der österreichischen Hauptstadt ist das künstlerische und intellektuelle Erbe allgegenwärtig. Nicht nur die kaiserlichen Paläste wie das Schloss Schönbrunn ziehen Besucher in ihren Bann. Im Museums Quartier können Sie in historischen und modernen Gebäuden unter anderem die Werke von Egon Schiele und Gustav Klimt bestaunen. Kombinieren Sie den Studientag mit persönlichem Erkunden dieser wundervollen Stadt.
Studienreise Wien: Buchen Sie jetzt!
Die Plätze sind auf 20 Teilnehmende beschränkt. Sie können die Tour «auf den Spuren Alfred Adlers» durch Wien verbindlich per E-Mail buchen. Senden Sie eine Email.
Bitte geben Sie folgende Informationen an:
- Name
- Adresse
- E-Mail und Telefonnummer
- Ich nehme am fakultativen Nachtessen teil. Bitte mit Ja oder Nein antworten.
Die Kosten sind mit CHF 125.- pro Person überschaubar. Darin enthalten sind Reiseführung, Organisation, komfortabler Transport durch Wien in einen Reisebus und fachliche Begleitung mit spannenden Impulsen, Geschichten und Anekdoten. Die Reise haben wir bereits mehrmals unternommen – Ablauf und Organisation haben sich bewährt. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.
Ca. Ende Juni 2025 erhalten Sie Detailinformationen zu Ihrer Anmeldung. Erst dann wird der Teilnehmerbetrag fällig. Gerne können wir Ihnen den Tag als Fortbildung attestieren.
Inspirierende Tage in Wien
Nutzen Sie die Gelegenheit: Verbringen Sie vorab oder im Anschluss an unsere Exkursion noch einige Zeit in dieser besonderen Stadt.
Einstimmung auf die Studienreise nach Wien
Zum Einstieg nimmt Sie Urs R. Bärtschi mit auf eine (Lese-) Reise in das historische Wien. Lassen Sie sich inspirieren!
Geschichte der Individualpsychologie: Alfred Adler – aktueller denn je!
Alfred Adler zählt ohne Frage zu den Pionieren der Psychologie. Sein Konzept der Individualpsychologie ist Teil der Tiefenpsychologie. Dieser Begriff fasst die psychologischen Schulen von Sigmund Freud, Alfred Adler und Carl Gustav Jung zusammen, die sich um die Erforschung des Unbewussten bemühten. Damals standen Freud, Adler und andere Personen im Kreuzfeuer der Kritik. Doch die Grundlagen von Psychoanalyse, Individualpsychologie und Analytischer Psychologie – wenn auch in modernisierter Form – sind heute fest in der Medizin verankert.
Die Geburtsstunde der Psychologie
1902 rief Sigmund Freud die legendäre «Mittwochs-Gesellschaft» ins Leben. Er war zu der Zeit 46 Jahre alt. In der «Mittwochs-Gesellschaft» trafen eine grosse Diskussionskultur, Kreativität und Pioniergeist aufeinander. Alfred Adler war vierzehn Jahre jünger als Freud und arbeitete als praktizierender Arzt.
Die Zusammenkünfte von anfänglich fünf Männern fanden jeden Mittwochabend in Freuds Wohnung statt. Im dichten Zigarrennebel wurden Vorträge gehalten und die Inhalte ausgiebig diskutiert. Die Gründungs-Mitglieder waren zweifelsohne mit einem Entdecker- und Erfinderfieber infiziert.
Alfred Adler nahm in der Mittwochs-Gesellschaft eine besondere Stellung ein. Er war stets anwesend und genoss als Vortragender sowie Diskussionsteilnehmer hohes Ansehen und grossen Einfluss. Trotzdem gehörten die letzten Worte immer dem Hausherren, Sigmund Freud. Das Wissen über die Diskussionsinhalte und den Ablauf stammt aus den detaillierten Protokollen, die ein Schriftführer von jeder Zusammenkunft anfertigte. Sie befinden sich im Archiv der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung. In den Jahren bis 1907 wuchs der Kreis auf 20 Mitglieder, im Jahr 1911 gehörten der Gesellschaft bereits 43 Personen an.
Die Grundlagen für die Psychoanalyse und Neurosentheorie wurden an diesen Mittwochabenden gelegt. Das Sigmund Freund Museum bietet Ihnen Einblicke in seine Privatpraxis. Hier behandelte Freud seine Patienten. Die Couch ist eindrücklich – eher ein Bettsofa – und wirkt ganz anders als das in den Hollywoodfilmen dargestellte rote Sofa.
Freud war passionierter Zigarrenraucher. Ganz bestimmt drang der Zigarrenrauch auch ins Behandlungszimmer. Robert Seethaler gelang in dem Buch «Trafikant» eine tolle Beschreibung des Zeitgeschehens. Auch wenn Sigmund Freud wohl keine Beziehung zu einem Kioskverkäufer unterhielt.
Tipp: Die Antwort auf die Frage, weshalb der Vater der Psychoanalyse die Sexualität so betonte und viele weitere spannende Details, erfahren Sie in der Biografie von Georg Markus «Sigmund Freud: Der Mensch und Arzt. Seine Fälle und sein Leben.»
Die drei Väter der Tiefenpsychologie
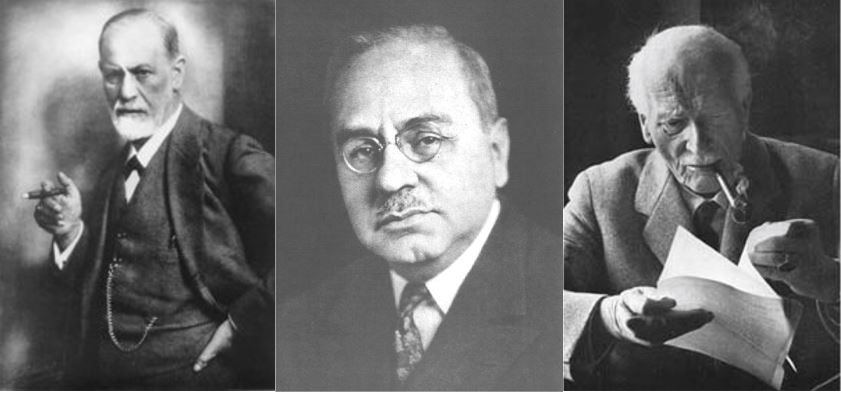
Sigmund Freud, 1856 – 1939, Alfred Adler, 1870 – 1937, Carl Gustav Jung, 1875 – 1961 (von links nach rechts)
Wien im 19 Jahrhundert: das ideale Umfeld für Psychologen
Um 1870 war Wien eine stark expandierende Stadt. Anlässlich der Weltausstellung 1873 entwickelte sich eine rege Bautätigkeit und eine Hochphase der Stadtentwicklung. Als Hauptstadt der österreichisch-habsburgischen Monarchie, war Wien ein Ort des Prunkes. Vor allem in den Gründerjahren blühte und gedeihte die Stadt auch wirtschaftlich. Aus allen Teilen der Monarchie strömten Menschen nach Wien. Die nahe Donau ermöglichte den Handel mit Ungarn und den Balkanländern. Wien war sowohl Warenlieferant als auch Absatzmarkt für österreichische Produkte.
Ausserdem führten alte Landhandelswege von Venedig über Wien in den Norden. Der «Orient-Express», der ab 1883 Paris und Konstantinopel verband, hielt ebenfalls in Wien. Die Handelsstadt hatte damals denselben Glanz wie Paris, Venedig und Mailand.
Das Wien der Jahrhundertwende prägte ein enormes kulturelles Erbe. Der Vielvölkerstaat der Habsburger mit seiner glänzenden Metropole war ein grosses multikulturelles Gebilde, in dem sich Kunst, Wissenschaft und Moderne entwickeln konnten. Um 1900 hatte Wien mehr als eine Million Einwohner. Zehn Jahre später war sie mit mehr als zwei Millionen bereits zur fünf grössten Metropole der Welt aufgestiegen.
«Hier blühten die Wissenschaft und die Kunst, Musik, Dichtung, Theater. Wiens blendende Bälle und Feste bewunderte man in ganz Europa, wo Strauss die «schöne blaue Donau» als Symbol freudigen Genusses bekannt gemacht hatte»[1].
Diese Gründerphase fand jedoch ein jähes Ende: Kurz nach der Eröffnung der Weltausstellung kam es zu einem verheerenden Börsenkrach. Die militärische Niederlage im Ersten Weltkrieg und der Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie führte zu einer katastrophalen wirtschaftlichen Situation. Wien war von Not, Hunger und Elend geprägt. Zu diesem Zeitpunkt übernahmen die Sozialdemokraten die Macht, nachdem sie bei den Kommunalwahlen 1919 mit überwältigender Mehrheit gewählt wurden.
In den Jahren 1923-33 realisierte das «Rote Wien» ein gross angelegtes Reformprogramm (Sozialer Wohnbau, Gesundheits- und Bildungswesen). Die politische Radikalisierung und der aufkommende Faschismus setzten den Reformen ein Ende. Nach einem dreitägigen Bürgerkrieg 1934 wurde Österreich ein autoritärer Ständestaat, den nun die «Vaterländische Front» regierte. Die sozialdemokratische Partei und ihre Organisationen wurden verboten. Der Austrofaschismus war Wegbereiter des Anschlusses an das nationalsozialistische Deutschland im Jahr 1938. Diese Entwicklung führte ab 1933 zu einer Emigrationswelle. Vor allem Juden wurden zur Ausreise gezwungen.
Wiens Denker und Philosophen
Das Wien des frühen 20. Jahrhunderts erlebte eine faszinierende Epoche, geprägt von einem intensiven kulturellen und intellektuellen Aufschwung. Diese Periode erstreckte sich vom späten 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg und war eine Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher, künstlerischer und wissenschaftlicher Veränderungen. Damals wurde die Grundlage für die modernen Denkweisen gelegt, die bis heute nachwirkt.
Hier spielte der «Wiener Kreis» eine zentrale Rolle. Dabei handelte es sich um eine aussergewöhnliche Gruppe von Philosophen, Mathematikern, Natur- und Geisteswissenschaftlern. Die Treffen fanden zwischen 1924 und 1936 regelmässig statt und die Teilnehmer setzten sich zum Ziel, eine wissenschaftliche Weltauffassung zu entwickeln und zu verbreiten. Sie versuchten, naturwissenschaftliche mit philosophischen Fragestellungen zu einer neuen, professionell eigenständigen Wissenschaftstheorie zu verbinden. Wien war ein Ort, wo sich Denker und Intellektuelle wohlfühlten und intensiv austauschten.
Drei Zeitgenossen Alfred Adlers möchte ich Ihnen hier kurz vorstellen, um die Genialität der damaligen Protagonisten zu unterstreichen.
Ernst Waldfried Josef Wenzel Mach (1838 – 1916) war ein Pionier der gerade entstehenden Wissenschaftsgeschichte. Nach ihm ist die Mach-Zahl benannt. Sie beschreibt die Geschwindigkeit im Verhältnis zur Schallgeschwindigkeit.
Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889-1951) gilt als einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Wittgenstein lieferte Beiträge zur Philosophie der Logik, der Sprache und des Bewusstseins.
Martin Mordechai Buber (1878-1965) war ein österreichisch-israelischer-jüdischer Religionsphilosoph. Sein bekanntester Satz lautet «Der Mensch wird am Du zum Ich».
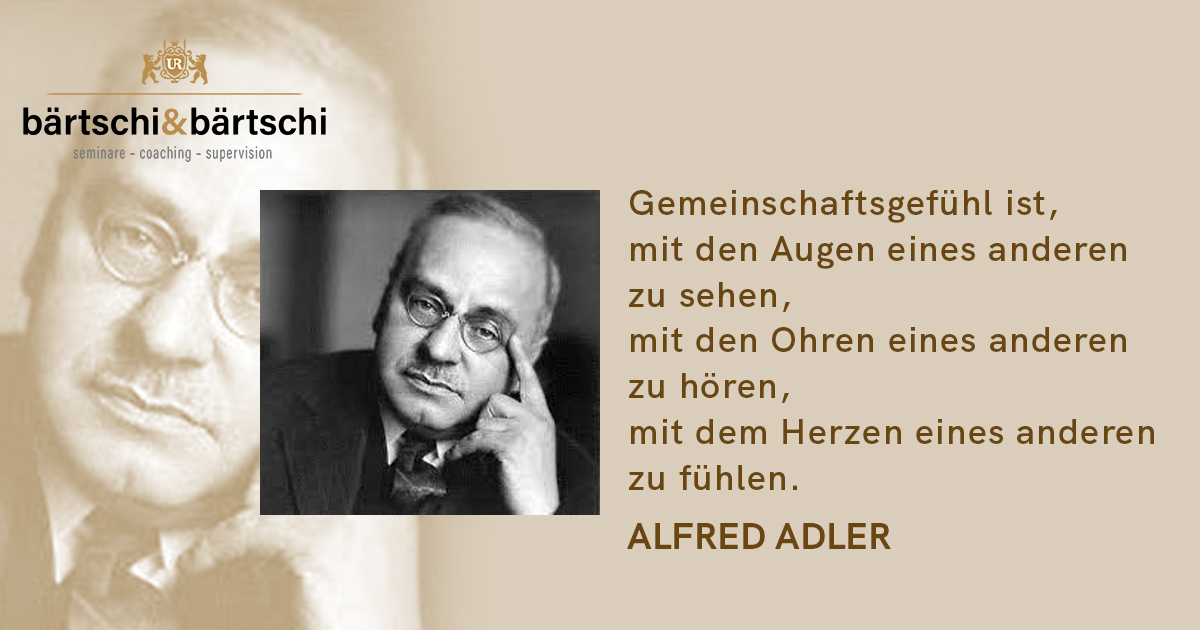
Wiener Kaffeehauskultur – eine wichtige Säule für die Entwicklung der modernen Wissenschaften
Die Wiener Kaffeehauskultur ist auch heute noch ein lebendiges Symbol der österreichischen Hauptstadt und eine Tradition, die bis ins 17. Jahrhundert zurück reicht. Ihre Entstehung ist eng mit der Einführung des Kaffees in Europa verbunden. Bereits kurz nach der Eröffnung der Kaffeehäuser entwickelten sie sich rasch zu einem Ort des (intellektuellen) Austauschs, der Geselligkeit und des gemütlichen Zusammenseins. Das Kaffeehaus galt als erweiterter Wohn- und Arbeitsraum, in dem man seine Zeit verbrachte, sich informierte und diskutierte.
Jüdisches Leben in Wien – Motor für die Wissenschaft
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts etablierte sich Wien als eines der grossen Zentren jüdischer Kultur. Wissenschaftler und Ärzte jüdischer Herkunft brachten den medizinischen Schulen und Universitäten viel Anerkennung ein. Namen wie Emil Zuckerkandl, Josef Breuer, Carl Sternberg, Adam Politzer, Viktor Frankl, Alfred Adler und Sigmund Freud zählen dazu.
Alfred Adler: ein strebsamer Mediziner
Sigmund Freud genauso wie Alfred Adler strebten eine Karriere als Forscher an. Freud habilitierte 1885 mit sämtlichen seiner bisher veröffentlichten Aufsätze. Im selben Jahr wurde er zum Privatdozenten der Neuropathologie ernannt. Der Weg zum Professorentitel war weit für Freud, aber er verfolgte sein Ziel unermüdlich. Am 5. März 1902 wurde er zum ausserordentlichen Universitätsprofessor ernannt. Diesen Titel verdankte Freud überwiegend seinem diplomatischen Geschick.
Bis zum Wintersemester 1918/19 las Freud an der Universität Wien. Zu Beginn referierte er über Anatomie und Neurologie, später über Themen wie die Psychologie des Traumes und schliesslich über die Psychoanalyse. Obwohl auch einige Freunde und Kollegen seine Vorlesungen hörten, waren die Veranstaltungen in der Regel schlecht besucht. Das kann auch an den ungewöhnlichen Vorlesungszeiten gelegen haben. Ab dem Sommersemester 1905 las Freud jeweils samstags zwischen 19 und 21 Uhr. Insgesamt 269 Personen sind in der Hörerliste aufgeführt, darunter nicht wenige, die in der Individualpsychologie eine Rolle spielten, etwa Rudolf Dreikurs oder Erwin Wexberg.
Die Grundlagen der Psychoanalyse waren geschaffen, das Unbewusste war entdeckt.
«Alle Bewegungen wie zum Beispiel auch das Gehen vollziehen sich unbewusst. Deswegen sagt man wohl, dass es unbewusst geschieht.» Alfred Adler, Lebensprobleme, Fischer Verlag, S. 22
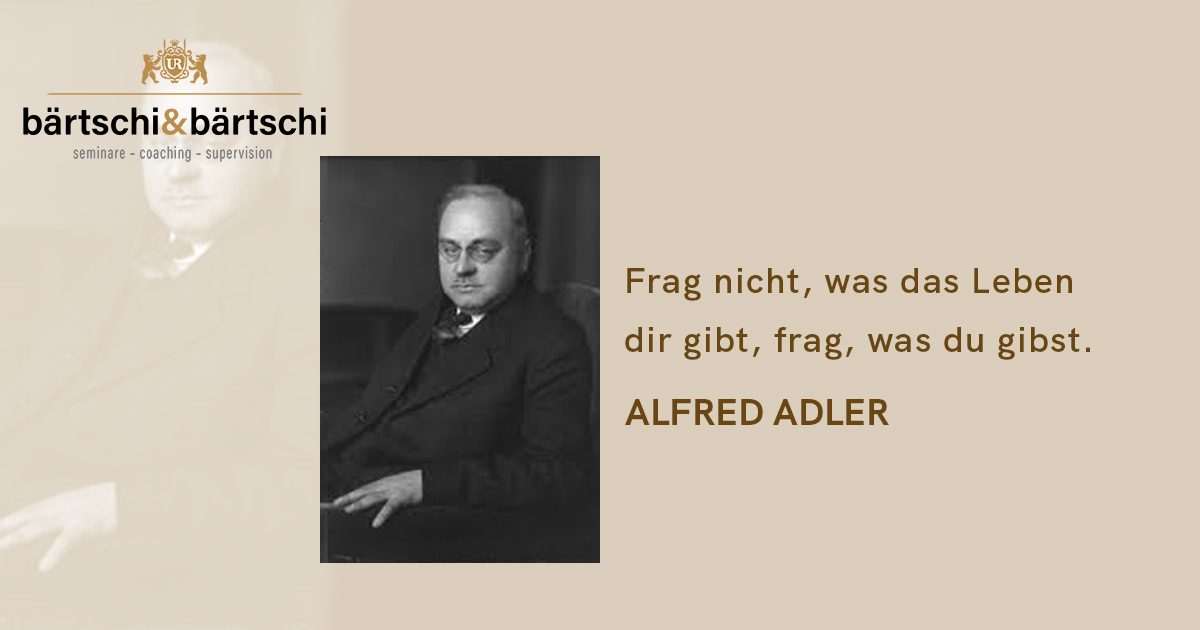
Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie
Wenden wir uns nun Alfred Adler und seinem Wirken zu. Die Individualpsychologie Alfred Adlers ist eine der drei klassischen Richtungen der Tiefenpsychologie. Adler wurde 1870 in Wien als zweites von sechs Kindern geboren. Im Alter von fünf Jahren erkrankte er an einer schweren Lungenentzündung. Diese Erfahrung sollte die Weichen für sein späteres Leben stellen: Er entschied in dieser Zeit, Arzt zu werden. Adler wollte in der Lage sein, den Tod zu überwinden.
Im Jahr 1895 doktorierte er als Mediziner an der Universität Wien und bereits mit 28 Jahren veröffentlichte er sein erstes Buch. Es handelte von der Gesundheit der Berufsgruppe der Schneider.
Als nächste wichtige Station in Adlers Biografie galt das Jahr 1911, als er den Kreis um Freud verliess und seine eigene Gruppe formte. Dieser Schritt bahne sich langsam an: Im Laufe der Zusammenarbeit mit Sigmund Freud hatte Adler seine eigenen Ansichten entwickelt, die er in mehreren Büchern publizierte.
Sigmund Freud war über diese Entwicklung nicht erfreut. Er hielt es für seine Pflicht, «seine Lehre rein und frei von allen mindernden Zutaten zu bewahren»[2]. Wahrscheinlich aus diesem Grund verhielt er sich in inhaltlichen Auseinandersetzungen nicht professionell, er wurde persönlich und verletzend.
Dieser Umstand offenbart: Die Charaktere von Freud und Adler waren zu unterschiedlich, als dass eine dauerhafte Zusammenarbeit der beiden Männer möglich gewesen wäre. Beide Pioniere verfügten über eine starke Persönlichkeit, so kam es zum Bruch mit weiteren Gefolgsleuten. So trennte sich Freud unter anderem von C.G. Jung und Adler distanzierte sich von seinem bedeutendsten Schüler Manes Sperber.
Darüber hinaus spielte die unterschiedliche soziale Herkunft der Patienten eine wichtige Rolle in dem Disput zwischen Freud und Adler. Freuds Patienten stammten zu drei Vierteln aus der Oberschicht. Die Klienten von Alfred Adler gehörten meist der Unter- oder Mittelschicht an. Die beiden Ärzte agierten in sehr unterschiedlichen Welten.
Alfred Adlers Individualpsychologie – die wichtigsten Stationen
Alfred Adler gab seinem psychologischen System den Namen «Individualpsychologie» und gründete 1912 mit sieben Gleichgesinnten die «Gesellschaft für Individualpsychologie». Nach dem Ersten Weltkrieg werden sein Einfluss und seine Bedeutsamkeit in Österreich durch die Erziehungsberatung an den Volksschulen sichtbar. Innerhalb weniger Jahre entstanden in Wien nahezu 30 Erziehungsberatungsstellen. Alfred Adler hat «fast immer und von Beginn an sämtliche Familienmitglieder gleichzeitig zu seinen Gesprächspartnern gemacht; er hat auch die Aussprache mit den Eltern vor den Kindern bzw. das Gespräch mit den Kindern in Anwesenheit der Eltern durchgeführt»[3]. Adler hatte die Aussprachen aber nicht nur gemeinsam mit Eltern und Kindern geführt. Stets war auch ein interessierter Zuhörerkreis anwesend.
Die Ära von Otto Göckel als Wiener Stadtschulrat war geprägt von einem tiefgreifenden Wandel im Erziehungs- und Bildungswesen. Mit der Gründung des Pädagogischen Instituts im Jahr 1923 und der Berufung von Alfred Adler als Professor 1924 wurde ein neuer Weg in der Lehrerausbildung beschritten. Ein wesentlicher Teil der Schulreform bestand darin, die Sozialisationsfähigkeit der Kinder zu fördern, die Eltern in schulische Belange einzubinden und Chancengleichheit in der Bildung herzustellen. Dabei wurden unter anderem sogenannte «Klassenbesprechungen» ins Leben gerufen. Diese Gruppenaussprachen hatten den Zweck, alle persönlichen, organisatorischen und didaktischen Anliegen der Schüler gemeinsam mit den Lehrern zu erörtern.
Der individualpsychologische Zugang, der sich in wenigen Therapiesitzungen nur auf die Interaktion in der Familie und ihr soziales Umfeld konzentrierte, führte zu enormen Widerständen aus dem psychoanalytischen Kollegenkreis. Kein Wunder, stellte Adler der Psychoanalyse doch ein anderes Konzept gegenüber.
Nach der Zerschlagung der Sozialdemokratie durch das austrofaschistische Regime im Jahr 1934 fanden die Schulversuche ein Ende und das alte autoritäre System wurde wieder eingeführt. Nach Kriegsende waren gerade mal noch drei «Adlerianer» in Wien verblieben, und zwar Oskar Spiel, Ferdinand Birnbaum und Karl Nowotny.
Adler selbst wanderte in die USA aus. Er wurde bereits 1926 zu Gastvorlesungen an der Columbia University eingeladen. Im Jahr 1932 folgte eine Professur für medizinische Psychologie am Long Island College of Medicine. In den folgenden Jahren verbrachte er die Sommermonate in Wien und lebte in der übrigen Zeit in den Staaten. Erst 1935 liess er sich endgültig in Amerika nieder.
Der 1937 veröffentlichte Titel «Lebensprobleme» offenbart Adlers aussergewöhnliche Intuition. «Diese auf den ersten Blick voreilig erscheinenden Schlüsse wurden dann im Allgemeinen von dem, was in der Krankengeschichte folgte, in überraschender Weise bestätigt. All dies zeigte eine mehr als gewöhnliche Intuition und eine ganz eigene Kunstfertigkeit» [4]
Alfred Adler starb 1937 im Schottischen Aberdeen, als der dort an der Universität einige Vorlesungen hielt.
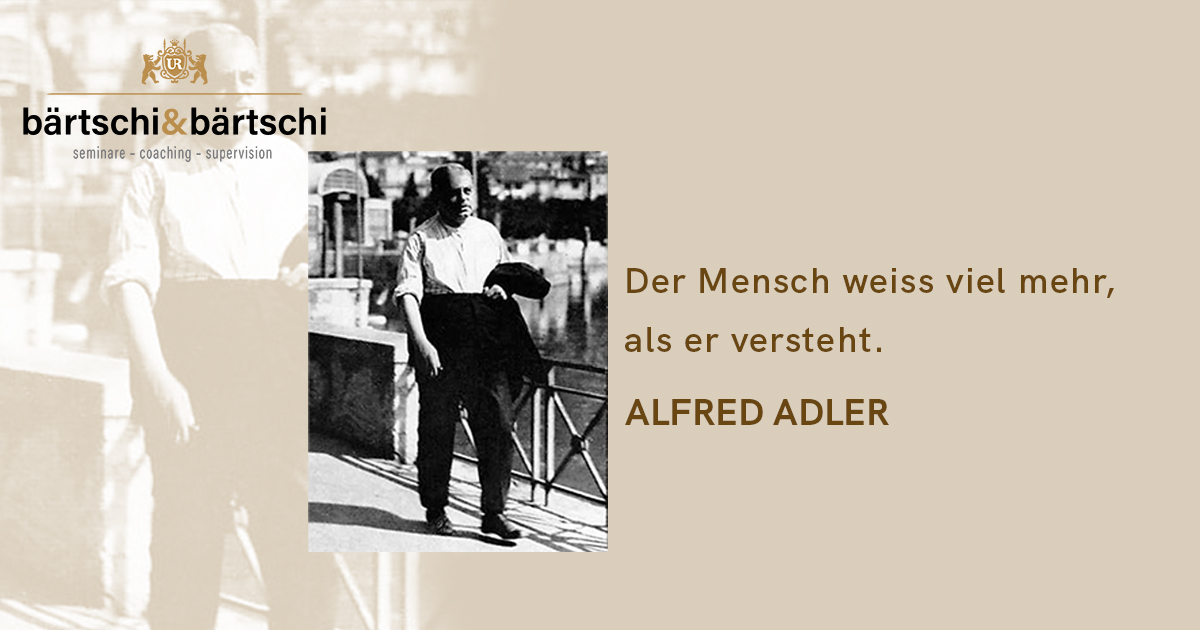
Herkunft, Einflüsse und Weltbild Alfred Adlers
Alfred Adler galt als tatkräftige Persönlichkeit, der sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen zahlreicher Menschen einsetzte. Sein Engagement reichte von der öffentlichen Gesundheit über die soziale Wohlfahrt bis hin zur Förderung von Frauenrechten. Auch für benachteiligte Kinder setzte er sich ein. Als Pionier der medizinischen Prävention und Gesundheitspsychologie hinterliess er eindrückliche Spuren in der medizinischen Landschaft. Seine Ideen zur Erwachsenenbildung, Lehrerausbildung sowie Familientherapie und -beratung prägten Generationen. Durch seine zahlreichen Schriften, Vorträge und seine aktive Praxis verbreitete sich die Individualpsychologie rasch in Europa und den USA. Trotz seines grossen Einflusses blieb Adler jedoch stets bescheiden und humorvoll. Sein Menschenbild wurde massgeblich von Hans Vaihingers beeinflusst. Vaihinger (1852-1933) veröffentlichte den Titel «Die Philosophie des Als-Ob». Darin argumentiert er, dass Fiktionen, obwohl sie konstruiert sind, das Denken erst ermöglichen. Dieser Gedanke prägte Adlers Konzept der Psychologie.
Hans Vaihinger: der Philosoph
In Vaihingers Welt bedeutet Erkenntnis, das Unbekannte mit Bekanntem zu vergleichen. Die Erkenntnis kommt an ihr Ende, wenn sich Unbekanntes nicht mehr auf Bekanntes reduzieren lässt. Nach Vaihinger kann der Mensch die Realität der Welt nicht wirklich kennen. Als Folge konstruiert er Denksysteme und glaubt, dass sie mit der Realität übereinstimmen. Im Ergebnis verhalten sich Menschen so, als ob ihr Verhalten in die Welt passt.
Vaihinger wunderte sich in seinem Buch darüber, dass Menschen falsche Annahmen treffen und dennoch zu richtigen Ergebnissen kommen. Wissen kann daher aus seiner Sicht nur pragmatisch begründet sein, nämlich dann, wenn sich Erfolg bei seiner Anwendung einstellt. Entscheidend ist, ob es nützlich ist, so zu handeln, als seien die Erkenntnisse wahr.
Alfred Adler «verlor» seinen Schüler Viktor Frankl
Viktor E. Frankl (1905-1997) wurde in der Czerningasse 6 geboren. Die fünfköpfige Familie bestand aus den Eltern, dem älteren Bruder Walter, der jüngeren Schwester Stella – und Viktor. Um den Zeitpunkt von Viktors Geburt hatte Alfred Adler sein Medizinstudium mit der Promotion längst abgeschlossen (1881). Schräg gegenüber Frankls Zuhause, in der Czerningasse 7, wohnte Adler für einige Zeit. Als Gymnasiast unterhielt Frankl eine Korrespondenz mit Sigmund Freud. Ein Manuskript, das er an Freud sendete, wurde in der Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse veröffentlicht. Freud unterstützte Frankl, doch Viktor Frankl wandte sich bereits 1924 Alfred Adler zu. Er studierte Medizin und beschäftigt sich mit dem Grenzgebiet zwischen Psychotherapie und Philosophie.
Disput zwischen Frankl und Adler: Der Schüler geht seinen eigenen Weg
Im Jahr 1926 benutzte Viktor Frankl zum ersten Mal den Begriff Logotherapie. Seine These war, dass der Mensch grundsätzlich ein entscheidungs- und willensfreies Wesen ist. Dieser Umstand befähigt ihn, zu inneren (psychischen) und äusseren (biologischen, sozialen) Bedingungen eigenverantwortlich Stellung zu nehmen.
Dies missfiel Alfred Adler. Wie jeder Pionier verteidigte Adler «seine Lehre» und schloss daher 1927 Viktor Frankl aus dem Verein für Individualpsychologie aus. Im Jahr 1947 veröffentlichte Frankl das Buch «… trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager», das heute unter dem Titel «Über den Sinn des Lebens» erscheint. Frankls «Logotherapie und Existenzanalyse» gilt als «Dritte Wiener Schule der Psychotherapie», nach Sigmund Freuds Psychoanalyse und Alfred Adlers Individualpsychologie.
Übrigens: 1933 veröffentliche Adler sein fünftes Hauptwerk: «Der Sinn des Lebens.» In seinem letzten grösseren Werk zeigt er den Konflikt zwischen subjektiver Sinngebung und objektivem Sinn.
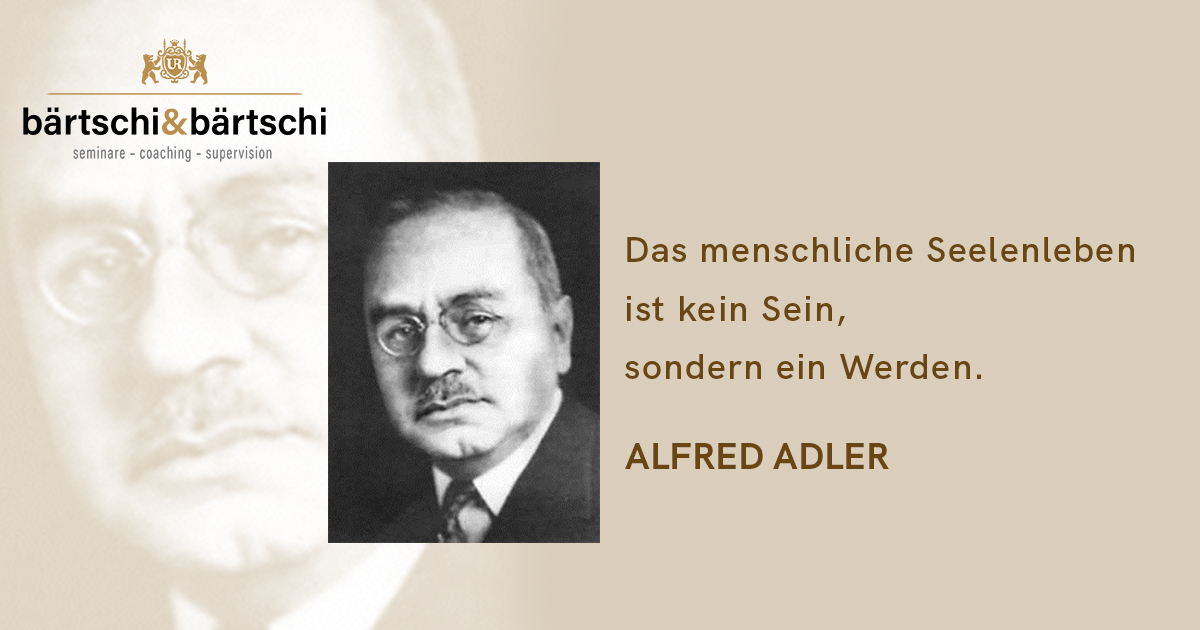
Quellenverzeichnis:





